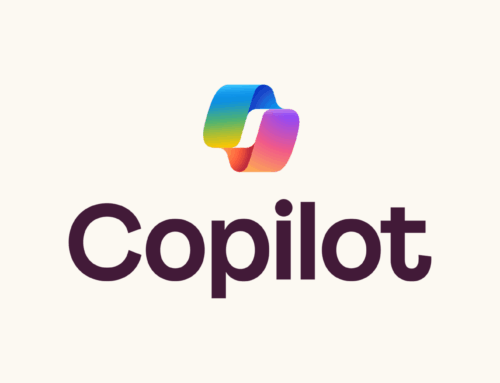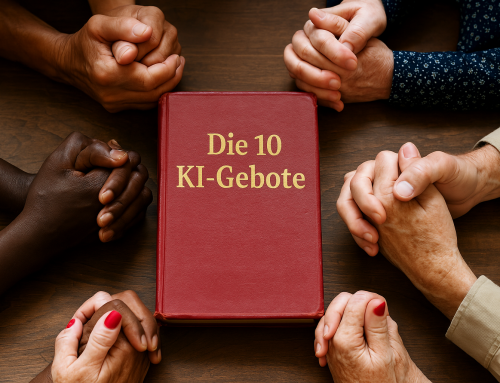Datenschutz im Fokus der Bundestagswahl: Ein Blick auf die Parteiprogramme 2025
Mit der Bundestagswahl 2025 stehen auch wichtige Fragen rund um Datenschutz und digitale Sicherheit im Mittelpunkt. Während sich alle Parteien für eine digitale Zukunft einsetzen, gehen die Ansätze doch teils stark auseinander. Wie positionieren sich die Parteien konkret zu Datenschutz, digitaler Souveränität und staatlicher Überwachung? Ein Blick in die Wahlprogramme zeigt teils markante Unterschiede.
SPD: Mehr Schutz und Transparenz für Bürger
Die SPD setzt sich besonders für den Schutz Betroffener von Hasskriminalität ein. Wohnanschriften sollen nicht mehr durch Akteneinsicht offengelegt werden, um Opfer besser zu schützen.
Gleichzeitig soll das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur zentralen Behörde für Cybersicherheit ausgebaut werden. Nutzer- und Unternehmensdaten sollen besser vor Angriffen geschützt werden und Plattformbetreiber sollen stärker in die Pflicht genommen werden, illegale Inhalte zu entfernen.
Eine „DeutschlandID“ soll Bürgern einen einfachen und sicheren Zugang zu Verwaltungsleistungen ermöglichen. Zudem plant die SPD ein digitales Gewaltschutzgesetz, um bildbasierte Gewalt und Spionage-Apps effektiver zu regulieren.
Die SPD legt zudem Wert auf den Ausbau der digitalen Infrastruktur und die Förderung digitaler Verwaltungsdienstleistungen unter Wahrung des Datenschutzes. Sie plant die Schaffung eines Datengesetzes, dass das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellt, und die Förderung einer vertrauenswürdigen Daten-Teilen-Infrastruktur.
Die Partei spricht sich für eine praxisnahe Verbesserung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und die Sicherstellung einer sicheren Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aus. Eine Klarnamenpflicht im Netz wird abgelehnt.
CDU/CSU: Pragmatismus und Datennutzung
Die Union setzt auf eine Balance zwischen Datenschutz und Sicherheitsinteressen und setzt sich somit für eine praxisorientierte Datenschutzpolitik ein. Die DSGVO soll alltagstauglicher gemacht werden, um Unternehmen, Behörden und Arztpraxen zu entlasten. Auch die Nutzung von Daten für Forschung und Gesundheitswesen soll erleichtert werden.
Sie plant die Einführung einer Digital- und Datenunion mit einer hochwertigen digitalen Infrastruktur und einem einheitlichen Datenschutzrecht.
Zudem sollen Einwilligungserklärungen und Cookie-Zustimmungen vereinfacht werden, beispielsweise durch einen freiwilligen Datenspendepass.
Die Union betont die Notwendigkeit, Daten als Innovationsmotor zu nutzen, und strebt eine Harmonisierung der Datenschutzaufsicht an.
Gleichzeitig sollen der Videoschutz an öffentlichen Gefahrenorten ausgebaut und die Voraussetzungen für den Einsatz automatisierter Gesichtserkennung geschaffen werden. Die Vorratsdatenspeicherung wird als Instrument im Kampf gegen Kindesmissbrauch befürwortet.
Genauso wie die SPD möchte die Union eine „DeutschlandID“ für eine effizientere digitale Verwaltung eingeführen.
In puncto KI und digitale Infrastruktur plant die Union, Innovationen zu fördern, Rechenkapazitäten auszubauen und Sicherheitsbehörden den Einsatz von KI zu ermöglichen. Dabei soll die Balance zwischen Datenschutz und Sicherheit gewahrt bleiben.
AfD: Gegen Überwachung und für digitale Souveränität
Die AfD lehnt staatliche Überwachung sowie den Einfluss großer Plattformbetreiber entschieden ab. Sie spricht sich für die Einführung einer Digitalsteuer für Tech-Riesen und den Einsatz von Videoüberwachung mit Gesichtserkennungssoftware an kriminalitätsneuralgischen Orten aus.
Sie fordert das Recht auf ein analoges Leben, lehnt verpflichtende Geschwindigkeitswarner und Social-Scoring-Systeme ab und spricht sich für die Abschaffung der DSGVO aus. Stattdessen soll ein nationales Datenschutzgesetz geschaffen werden.
Zudem will die Partei mehr digitale Souveränität durch Open-Source-Technologien und eigene Hard- und Softwarelösungen für kritische Infrastrukturen erreichen. Auch in der KI-Regulierung setzt sie auf nationale statt europäischer Lösungen.
Die Stärkung der Datenschutzbehörden und die gesetzliche Verankerung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sind weitere Punkte ihres Programms.
Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW): Datenschutz mit Fokus auf digitale Unabhängigkeit
Das BSW spricht sich gegen staatliche und privatwirtschaftliche Massenüberwachung aus und lehnt Maßnahmen wie Vorratsdatenspeicherung strikt ab.
Zudem fordert es eine stärkere Nutzung von Open-Source-Software und eine eigenständige digitale Infrastruktur.
Gleichzeitig warnt es vor digitalen Zwangsmaßnahmen wie der Pflicht zur elektronischen Rechnungsstellung.
FDP: Bürokratie abbauen, Datenschutz vereinfachen
Die FDP fordert eine Vereinheitlichung der Datenschutzaufsicht, um bürokratische Hürden abzubauen und Unternehmen mehr Rechtssicherheit zu geben. Statt 18 Aufsichtsbehörden soll eine zentrale Instanz klare und verbindliche Regeln schaffen.
Zudem setzt sich die Partei für die Netzneutralität ein, um Startups und mittelständischen Unternehmen faire Wettbewerbsbedingungen zu sichern.
Beim Thema Meinungsfreiheit warnt die FDP davor, dass Plattformbetreiber durch neue Regulierungen zu privaten Zensoren werden – digitale Debatten müssen frei bleiben.
Die Freien Demokraten plädieren zudem für die Einführung eines Deutschlandportals, das Bürgern Einblick in alle staatlich gespeicherten Daten gewährt und bei behördlichen Zugriffen informiert.
Sie fordern ein Recht auf Verschlüsselung und lehnen den Einsatz von Staatstrojanern ab, solange der Schutz der privaten Lebensgestaltung nicht gewährleistet ist.
Anstelle der Vorratsdatenspeicherung favorisiert die FDP das Quick-Freeze-Verfahren, bei dem im Verdachtsfall bestimmte Daten auf richterliche Anordnung gesichert werden.
Flächendeckende Videoüberwachung und automatisierte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum werden abgelehnt.
Die Linke: Datenschutz als Grundrecht
Für die Linke ist Datenschutz ein fundamentales Bürgerrecht. Sie lehnt Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner und biometrische Videoüberwachung entschieden ab.
Stattdessen fordert sie mehr Transparenz und Open-Source-Lösungen, insbesondere für öffentliche Verwaltungen.
Die Macht großer Tech-Konzerne soll begrenzt werden, indem personalisierte Werbung verboten und Kartellrecht konsequenter angewendet wird.
Auch in Bildung und Gesundheit sollen Datenschutzstandards verbessert werden, indem KI-basierte Bewertungen und kommerzielle Nutzung von Gesundheitsdaten verhindert werden.
Die Linke fordert ein Beschäftigtendatenschutzgesetz und die Verpflichtung von Plattformen wie Airbnb zur Datenweitergabe an öffentliche Behörden.
Bündnis 90/Die Grünen: Datenschutz vereinfachen, aber stärken
Die Grünen wollen Datenschutz effizienter und weniger bürokratisch gestalten, ohne das Schutzniveau zu senken. Sie fordern eine Reform der Datenschutzaufsicht und klare Regeln für Beschäftigtendatenschutz.
Gleichzeitig lehnen sie staatliche Massenüberwachung, Vorratsdatenspeicherung und Chatkontrollen ab. Stattdessen setzen sie auf evidenzbasierte Überwachungsmaßnahmen und ein Quick-Freeze-Verfahren zur Strafverfolgung. Ein Digitalministerium soll die Digitalpolitik bündeln und Interoperabilität zwischen IT-Systemen fördern.
Die Grünen setzen sich für klare gesetzliche Regelungen für dezentrale Datenpools und Datentreuhandmodelle ein, insbesondere im Kontext von Künstlicher Intelligenz.
Sie befürworten die Entwicklung einer europäischen Cloud-Infrastruktur auf Basis von Open-Source-Technologien und den sicheren Zugriff von Patienten auf digitale Gesundheitsinformationen.
Die anonymisierte Nutzung von Gesundheitsdaten für wissenschaftliche Zwecke soll mit Einwilligung der Betroffenen ermöglicht werden.
Datenschutz im politischen Diskurs: Ein abschließendes Fazit
Die Ansätze der Parteien zeigen deutlich unterschiedliche Prioritäten. Während SPD und Linke den Fokus auf Bürgerrechte und Schutz vor Überwachung legen, setzen CDU/CSU und die Grünen auf pragmatische Lösungen zur Vereinfachung von Datenschutz und Digitalisierung. Die BSW betont hingegen die Bedeutung digitaler Unabhängigkeit und lehnt staatliche Massenüberwachung ab, während die AfD hingegen einen dezidiert ablehnenden Kurs gegenüber EU-Vorgaben verfolgt und die Abschaffung der DSGVO befürwortet. Die FDP legt ihren Schwerpunkt auf den Abbau von Bürokratie und eine einheitliche Datenschutzaufsicht, um Unternehmen mehr Rechtssicherheit zu geben. Unabhängig vom Wahlausgang wird Datenschutz ein zentrales Thema für Unternehmen, Bürger und den Staat bleiben.